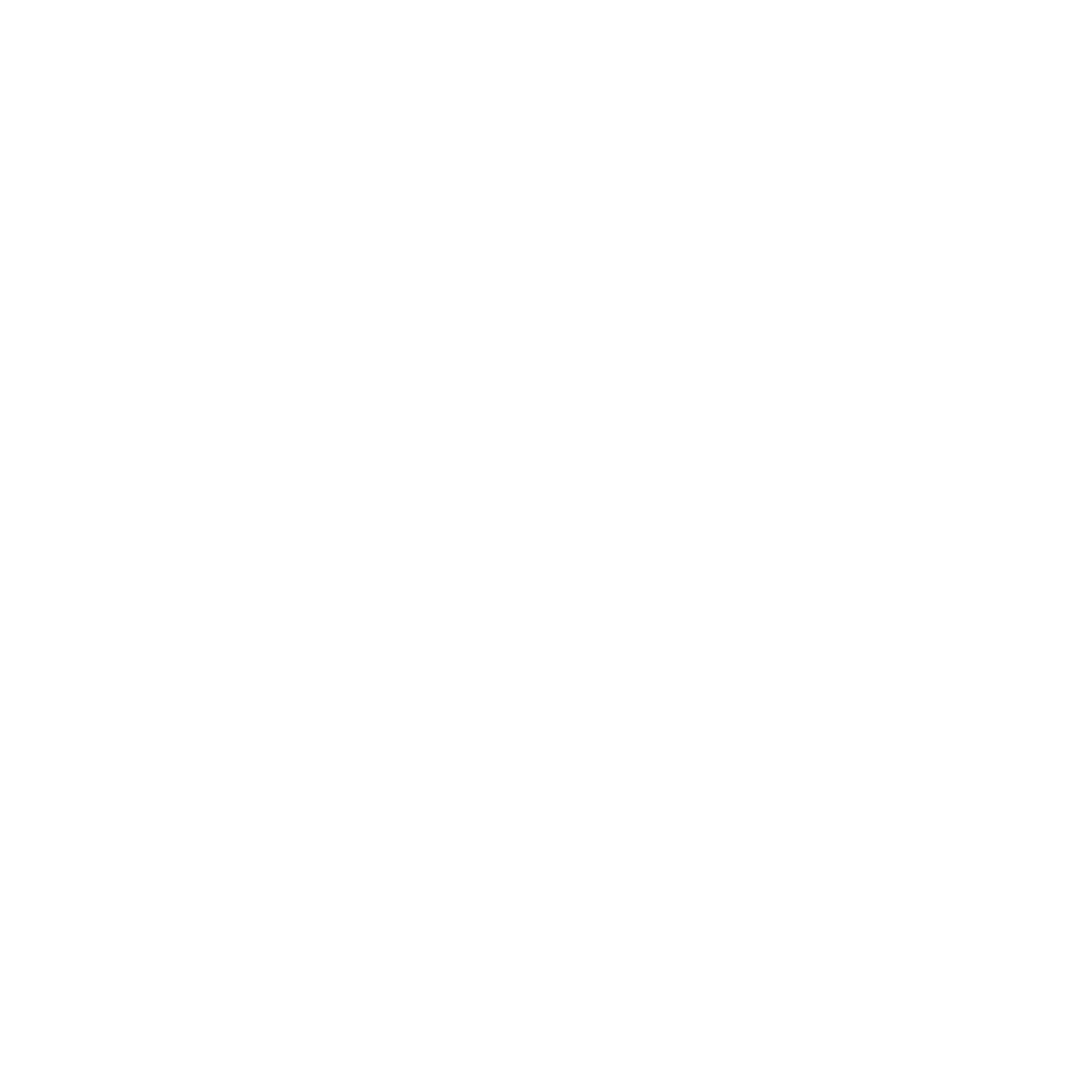Coffee & Cigarettes
John Peel
„Übertriebener Respekt
belastet mich.“
„Wenn ich Sie nachher durchs Haus führe, werden Sie das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe selbst sehen. Soweit ich weiß, besitze ich allein um die 30.000 Vinyl-Singles.“
Rubrik
Coffees & Cigarettes
Date
19. / 20. Februar 2004
Ort
Suffolk, England
Fotos
Claus Geiss
19.02.2004, Finborough, England. John Peels verwinkeltes Anwesen liegt in einem Dörfchen in der Grafschaft Suffolk. Der legendäre Radio-DJ nimmt sich zwei Tage Zeit. Das Haus aus dem 17. Jahrhundert wirkt wie ein Lager für Tonträger. Überall liegen Vinyl-LPs und CDs, selbst hinter Klappen und in Winkeln stapeln sich Platten.
Mr. Peel, Ihr langjähriger Produzent bei der BBC, John Walters, nannte Sie „eine der wichtigsten Figuren der britischen Popgeschichte“. Sie hätten in Ihren 40 Jahren als Radio-DJ mehr für die Entwicklung des Pop getan als jeder sonst – „John Lennon inbegriffen“. Der ‚NME‘ bezeichnete Sie 1994 gar als „gottgleiches Genie“. Wie fühlt man sich da?
Nun… ich weiß natürlich, warum John, der ja immerhin über 20 Jahre meine Sendung betreute, diese Dinge über mich gesagt hat. Worauf er hinaus wollte, ist Folgendes: Der Unterschied zwischen einem Radio-DJ und einem Print-Journalisten liegt darin, dass du die Neuigkeiten eben nicht nur beschreibst, sondern die Möglichkeit hast, sie den Hörern da draußen direkt vorzustellen. Das ist ein substanzieller Unterschied, was den Prozess der Meinungsbildung betrifft. Davon abgesehen hat John Lennon natürlich viel mehr Geld verdient und bessere Songs geschrieben als ich. (lacht) Im übrigen hat er auch eine ganze Menge schrecklichen Kram komponiert, was die Leute gerne vergessen. Wäre Lennon nicht erschossen worden – die Menschheit hätte ihn für seine letzte Platte zu Recht ausgelacht. Aber im Ernst: Wie misst man Wichtigkeit oder Einfluss? Der ‚NME‘ jedenfalls ist wohl kaum ein Maßstab.
Mag sein. Selten jedoch sind sich die Leute derart einig wie in Ihrem Fall.
Dennoch: Zwischen selbstloser Hingabe ans öffentliche Radio und einem schockierenden Mangel an Ambition ist es nur ein schmaler Grat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 1998 hatte ich die Ehre, einen vom Königshaus gestifteten Preis in Empfang zu nehmen. Im Buckingham Palast, von Prinz Charles persönlich. Natürlich nahm ich die Geschichte nicht allzu ernst, doch immerhin gab uns dieser Anlass die Chance, die Bude mal von innen zu sehen. (kichert) Diese Auszeichnung kann jeder bekommen, man muss lediglich eine bestimmte Sache für eine verrückt lange Zeit getan haben. Es waren Hunderte von Leuten dort – von der Blumen-Arrangeurin bis hin zum Rekord-Maurer. Ist wohl eine große Sache, aber ich kam mir eher so vor, als stände ich in der Warteschlange für den schiefen Turm von Pisa.
Jedenfalls sind Sie eine weithin respektierte Legende.
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber mir gefällt dieser Gedanke überhaupt nicht. Selbst bei Radio 1 sagen sie gerne Dinge wie „die Legende John Peel“, nur: impliziert das nicht automatisch, dass man bereits tot oder zumindest passé ist? Vor einigen Wochen fragte mich die hiesige Radio Akademie, ob sie mich in ihre ‚Hall Of Fame‘ aufnehmen dürfe. Ich lehnte ab, weil ich mich so einfach nicht begreife. Ruhm bedeutet mir nichts. Natürlich nahmen sie mich dennoch auf. Und natürlich behielt ich Recht: Vier Fünftel der Mitglieder sind längst unter der Erde. Wissen Sie, übertriebener Respekt belastet mich. Zum Glück respektieren mich wenigstens meine eigenen Kinder nicht die Bohne. (lacht) Ich bin ihr etwas schrulliger Vater – und erst ganz am Ende der Fahnenstange womöglich so etwas wie eine Radio-Legende.
„Der Unterschied zwischen einem Radio-DJ und einem Print-Journalisten liegt darin, dass du die Neuigkeiten eben nicht nur beschreibst, sondern die Möglichkeit hast, sie den Hörern da draußen direkt vorzustellen.“
Fallen Ihnen überhaupt Menschen ein, die Ihrer Arbeit kritisch gegenüber stehen?
Na klar! Ich bekomme sehr wohl auch Hass-Post. (wühlt in einem Stapel Papier) Diese Karte hier fand ich erst heute morgen im Briefkasten. Ich zitiere: „Bitte tun Sie mir den Gefallen und scheren Sie sich aus dem Äther. Ihre widerliche Stimme verletzt meine Gefühle. Ihre Sendung bringt auf den Punkt, was aus Großbritannien geworden ist. Ach ja: Vergessen Sie meine Adresse. Ich bin längst nach Frankreich ausgewandert!“ Böse, nicht? (lacht)
Nicht schlecht, ja. Barney Hoskyns vom ‚Independent‘ hat ihre Arbeit einmal mit folgenden Worten charakterisiert: „Peel bewirkt, dass die Leute sich als Teil eines Ganzen begreifen, das größer ist als sie selbst.“ Ist das Ihr Anspruch?
Es gibt kein bewusstes Ziel. Zumindest keines, das weit über meine Person hinaus reicht. Wenn ich also tatsächlich so etwas bewirke, dann nur, weil es mich selbst befriedigt. Und weil ich als Kind im Grunde eine ähnliche Erfahrung machen durfte, was das Radio betrifft. Ich wuchs in einem ziemlich abgeschiedenen Flecken Nordenglands auf, und in den Vierziger Jahren sah es mit öffentlichen Verkehrsmitteln alles andere als rosig aus. Du musstest dich selbst unterhalten. Radio Luxemburg und der aus Deutschland sendende AFN waren meine einzigen Verbündeten damals; Stuttgart hatte das beste Signal. Man musste sich zwar durch einen Haufen schreckliches Zeug wühlen, aber ab und an brachten sie umwerfende Stücke.
Zum Beispiel?
Meine erste Bekanntschaft mit Elvis‘ „Heartbreak Hotel“ etwa war geradezu biblisch. Was das in mir auslöste, kann man sich heute nur noch schwer ausmalen. Als sei vor meinen Augen ein splitternackter Mann durchs Wohnzimmer gerannt! Ich bin verliebt in die Idee, dass es während jeder meiner Sendungen irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der eine ähnliche Erfahrung machen darf. Der mit einem Stück Musik konfrontiert wird, das ihn im Sturm nimmt und nicht wieder loslässt. Und wenn ich die E-Mails sehe, die ich bekomme, dann passieren diese Dinge tatsächlich.
Sogar mir selbst ging es schon so, dass ich nachts plötzlich das Auto anhalten musste, um mir am Straßenrand einen Song, den Sie gespielt haben, zu Ende anzuhören.
Sehen Sie, darum geht es. Um diese Magie. Bei mir war es „Stranger Blues“ von Elmore James. Ich war spät nachts unterwegs zurück von New Orleans nach Dallas, wo ich in den Sechzigern eine Weile lebte. Mitten in der endlosen, nur vom Asphaltband des Highway durchzogenen Einöde im Osten von Texas spielte Wolfman Jack plötzlich dieses Lied. Genau in dem Moment, als die ersten Akkorde einsetzten, fuhr ich über eine Hügelkuppe – und vor mir im Tal lag dieser kleine Ort. James sang „I’m a stranger here / I just drove in your town.“ Es war perfekt! Wetter, Musik, die Straße, ich – alles war auf magische Weise in Beziehung zueinander getreten. Etwas Ähnliches widerfuhr mir wenig später noch einmal in Oklahoma mit Otis Reddings „Old Man Trouble“. Das sind unvergessliche Momente. (wühlt in einem Papierstapel) Hier: Das ist die Setlist meiner kommenden Sendung. Da werde ich unter anderem einen Track der deutschen Band FSK spielen, bei dem sich einige Hörer am Kopf kratzen werden. Wirklich verblüffendes Zeug!
Kann man sagen, dass topografische Grenzen zunehmend verwischen? Dass es immer unwichtiger wird, woher eine Band genau stammt?
Da ist was dran, ja. Ich bin zum Beispiel kürzlich über eine fantastische Gruppe namens Fotlmotl aus der Ukraine gestolpert. Die singen französisch, und zwar, soweit ich das beurteilen kann, sogar akzentfrei! Diese CD hier – ebenfalls aus der Ukraine – habe ich heute morgen geschickt bekommen. Und seien Sie sicher: Ich werde sie mir gut anhören. Vielleicht ist sie absoluter Müll. Vielleicht aber auch nicht.
„Wenn man in meinem Alter auf ein Konzert geht, gibt es zwei Möglichkeiten: Man erkennt mich nicht und denkt, ich wäre dort, um junge Mädchen anzutatschen. Oder man erkennt mich und redet auf mich ein. Beides ist misslich.“
Sie haben mir vorhin verraten, dass Sie pro Woche um die 250 Tonträger und Demos zugeschickt bekommen. Wie wollen Sie das alles hören? Es müssen Ihnen doch etliche gute Platten durch die Finger rinnen.
Ich gebe zu: Das ist ein Problem. Wenn ich Sie nachher durchs Haus führe, werden Sie das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe selbst sehen. Es ist zu viel! Soweit ich weiß, besitze ich allein um die 30.000 Vinyl-Singles. Mir bleibt meist nichts anderes übrig, als mich auf meinen durch jahrelange Erfahrung geschulten Instinkt zu verlassen. Ich selektiere nicht selten nach optischen Gesichtspunkten vor und höre dann so viel an, wie ich schaffe, wofür bestimmt zwei Drittel meiner täglichen Arbeitszeit draufgehen. Zum Glück weiß ich fast immer sofort, ob eine Band etwas taugt oder nicht. Aber die meisten Demos, die ich bekomme sind bestenfalls… na ja: irgendwie okay.
Gehen Sie noch auf Konzerte?
Kaum, wenn ich ehrlich bin. Hier in der Gegend findet so gut wie nichts statt, und ich arbeite in der Regel sowieso um die 14 Stunden am Tag. Ich schaue mir lieber Fußballspiele oder seltsame amerikanische Reality-Sendungen im Fernsehen an. Am liebsten diese schrägen Formate, wo ein Kamerateam den Einsatz einer Polizeistreife begleitet oder ähnliches. Da lernt man mehr über dieses Land und seine paranoiden, rassistisch veranlagten Bürger als durch Michael Moores gesammelte Werke. Außerdem: Wenn man in meinem Alter auf ein Konzert geht, gibt es zwei Möglichkeiten: Man kennt mich nicht und denkt, ich wäre dort, um junge Mädchen anzutatschen. Oder man erkennt mich und redet auf mich ein. Beides ist misslich.
Gibt es denn noch neue Songs, die Sie so richtig aus den Angeln heben können?
Was mich persönlich betrifft – womöglich nicht. So etwas wie bei „Heartbreak Hotel“ ist mir jedenfalls seitdem nie wieder passiert. Aber zum Glück geht es ja nicht nur um mich, sondern vor allem um meine Hörer. Ich bin übrigens sehr froh, dass es heute E-Mail gibt, ich schätze diese Art der direkten Rückmeldung überaus. Neulich habe ich ein Lied gespielt und noch während der Sendung mailte mir ein Typ aus Japan: „But have you listened to the b-side?“ Hatte ich nicht. Also schmiss ich das Set um und legte sie auf. Und sie war wirklich fantastisch!
Derart flexibel konnten Sie aber nicht von Beginn an sein, oder?
Nein, natürlich nicht. Noch Jahre, nachdem Radio 1 1967 gegründet worden war, verlangte die BBC, dass man jeden gespielten Titel im Vorhinein penibel auflistete und nicht davon abwich – inklusive Laufzeit, Label und dem ganzen Kram. Für die waren DJs Aushängeschilder ohne eigenen Geschmack, die dem Sender nach außen ein Gesicht gaben – und irgendwann zum Fernsehen wechselten. Ich wollte das nie. Ich sehe mich eher als den Vertreter des Volkes, der zufällig beim Radio gelandet ist. Als einen Musikfan, der mit einer Plastiktüte voller Platten irgendwie durch die Tür ins Studio gerutscht ist. (lacht) Daran hat sich bis heute nichts geändert.
„Ich hege zwar den Wunsch, ein Revolutionär zu sein, bin dafür aber innerlich wohl doch zu konservativ.“
Lassen Sie uns ein wenig in die Vergangenheit abschweifen. Was könnte dafür verantwortlich gewesen sein, dass Sie bereits einer Ihrer Grundschullehrer „a thoroughly beastly boy“ genannt hat?
Ich schätze, ich war ein bisschen abwesend. Scheu. Und dabei auch noch extrem stur, was in der Tat eine komplizierte Kombination ist. Das meiste, was man mir auftrug, hatte ich im nächsten Moment vergessen.
Fallen Ihnen Gründe für Ihr abwesendes Verhalten ein?
Inzwischen glaube ich, dass die bewusste Sabotage der mir aufgetragenen Aufgaben die einzige Möglichkeit für mich war, eine eigene Identität zu entwickeln. Ich hasste die Schule und wurde über diesen Hass ich selbst. Mir war es komplett egal, ob andere mein privates Aufrührertum bemerkten oder nicht. So lange zumindest ich darum wusste. Ich hatte auch jahrelang ein Paar dieser Anfang der Fünfziger bei Teddy-Boys irre angesagten Drain-Pipe-Hosen im Schrank, zog sie aber nie an. Ich besaß die Dinger, das reichte. Ich war der Typ, dessen Schulanzug eine winzige Nuance heller war als alle anderen, was nie jemandem aufgefallen ist.
Im Grunde sind Sie noch heute ein bisschen so: Der scheue Pop-Revolutionär, der fernab der Metropole London im Grünen residiert, vier Kinder hat und eine glückliche Ehe führt.
Das ist nicht gerade Rock’n’Roll, oder? Mein Problem ist folgendes: Ich hege zwar den Wunsch, ein Revolutionär zu sein, bin dafür aber innerlich wohl doch zu konservativ. Ich bin ein einfacher Typ, der seine Träume und Visionen in Form von Songs durch den Äther schickt.
Wie kamen Sie überhaupt zum Radio?
Ich hatte zuerst nicht den Schimmer einer Idee, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Mein Vater schickte mich 1960 nach der Armee in die Staaten, damit ich – wie er es nannte – „auf eigenen Füßen zu stehen lerne“. Ich begann auf dem Baumwoll-Großmarkt in Dallas zu arbeiten und verfolgte regelmäßig eine Sendung namens „Kat’s Karavan“ auf WRR. Nachts konntest du dort neben den damals ungemein populären Platten von Comedians wie Jonathan Winters oder dem lokalen Idol Brother Dave Gardener eine ganze Menge meist akustischen Rhythm’n’Blues hören. (überlegt) Mein Gott, da war echt kurioser Stoff bei – etwa ein Typ namens Ransom Knowling, der mit dem Mund einen Kontrabass nachahmte und dessen Plattencover stets in Französisch verfasst waren. (lacht) Wie dem auch sei, ich hatte einige Platten von zu Hause mitgebracht, und eines Tages trat WRR über einen Bekannten an mich heran und fragte, ob ich nicht als Gast in die Sendung kommen wolle. Das tat ich einige Wochen, aber sobald ich ein bisschen Geld dafür sehen wollte, jagte man mich zum Teufel.
Doch Sie hatten Blut geleckt. Wie ging es dann weiter?
Dann kamen die Beatles und ein Typ namens Russ „The Weird Beard“ Night, der bei KLRF eine Show über die Band und die Szene in Liverpool machte. Das Dumme war: Er hatte keine Ahnung davon. Als er erfuhr, dass ich von dort stamme, lud er mich prompt ein. Als Experten sozusagen. Ich wusste zwar ebenfalls nicht allzu viel, aber so sind sie eben, die Amerikaner. Die dachten: „England? Da leben bestimmt nicht mehr als 100 Menschen. Die müssen sich alle persönlich kennen.“ (lacht) Einige Tage später hatten wir einen Termin in einem Plattenladen, und man musste mich bereits durch den Hintereingang ins Gebäude schleusen – die gesamte Straße war voller kreischender Mädchen, die den Mann sehen wollten, der die Beatles kannte! Absurd.
Aber bestimmt auch spannend.
Natürlich, vor allem für einen jungen Mann wie mich. Allein mein Akzent ließ sie reihenweise in Ohnmacht fallen. Wann immer ich nach Downtown Dallas hinein fuhr, wurde ich von kleinen Gruppen von Mädchen verfolgt. Kurz darauf trat ich meinen ersten regulären Job in Oklahoma City an.
1967 gingen Sie trotzdem zurück nach London, wo Sie bei Radio London, einem Piratensender, anheuerten. In dieser Zeit wurde aus John Robert Parker Ravenscroft John Peel.
Es war Standard in diesen Tagen, dass man unter Pseudonym arbeitete. Mein richtiger Name war denen wohl zu lang. Irgendeinem Mitarbeiter fiel dann Peel ein. Und, tja… ich befand mich kaum in der Lage, mich zu widersetzen.
„Ich kann moderne Geräte bedienen, wenn sie für mich von Nutzen sind. Mehr nicht. Wenn mir einer das Zeug erklären will, winke ich ab.“
Wie hat man sich den Alltag dort vorzustellen?
Wir sendeten von einem Schiff aus, das außerhalb der britischen Hoheitsgewässer ankerte, also legal nicht antastbar war. Alle 14 Tage wechselte die Besatzung. Die sich gerade entwickelnde Jugendkultur besaß noch kein Sprachrohr, insofern bestand rege Nachfrage nach solchen Sendern. Erst als der Laden dicht gemacht wurde, wachte die BBC auf und gründete Radio 1. Ich gab dem Ganzen allerdings nicht lange.
Warum?
Weil der Sender von einer solchen Art Radio schlicht keine Ahnung hatte. Sie müssen sich das mal vorstellen: Unsere Sendungen waren die ersten, die bei der BBC jemals ohne minutiöses Skript auskamen. „Top Gear“, mein erstes Format, mussten wir trotzdem noch komplett doppelt fahren – einmal als Durchlaufprobe, erst dann on air. Da war nichts mit Spontaneität.
Stimmt es, dass die legendären „Peel Sessions“ – also die Anordnung, eine Band einige ihrer Songs explizit für Ihre Sendung aufnehmen zu lassen – lange Zeit eher eine Art Notbehelf war?
Ja, so kann man das sehen. Die Musiker-Gewerkschaft besaß damals großen Einfluss, und ihre Mitglieder waren finanziell stark abhängig von den BBC-Jobs. Also installierte man kurzerhand eine Art Gesetz, das die Netto-Spielzeit der pro Tag gesendeten Album-Tracks begrenzte und auf die einzelnen Shows verteilte. Für den Rest engagierte man klassisch ausgebildete Orchester, die populäre Songs coverten. Wie Sie sich denken können, begann das System spätestens mit der Gründung von Radio 1 ins Absurde abzudriften. „Purple Haze“ von Jimi Hendrix inklusive Solo, interpretiert vom Northern Dance Orchestra der BBC – es war bizarr!
Scheint so.
Und es geht noch absurder: Wenn Sie als Deutscher nach Swinging London kamen und nachts das Radio einschalteten, hatten Sie hervorragende Chancen, dem Radio-Tanzorchester Baden-Baden dabei zuzuhören, wie es Beatles-Nummern verhunzte. Andere Redakteure überspielten Platten auf Tape und versuchten, damit durchzukommen. Wir hatten ziemlich bald die Idee, lieber Original-Bands einzuladen und die missliche Lage kreativ zu nutzen, indem man sie unveröffentlichtes Material oder alternative Versionen aufnehmen ließ. Erst 1988 wurde das intern als ‚Needletime’ bekannte System endgültig abgeschafft.
Fallen Ihnen Sessions ein, bei denen das Konzept überhaupt nicht aufging?
Kaum welche. Morrissey bat uns, eine Aufnahme, die wir selbst gut fanden, nicht zu senden. The Clash scheiterten am Gesang und schoben hinterher alle Schuld auf unsere Technik. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was das mit Punk zu tun hat! (lacht)
Wenn man sieht, wie lange Zeit Ihres Lebens Sie dieser Passion nun bereits widmen, dann fragt man sich schon, was Sie immer noch weitermachen lässt.
(lacht) Ich weiß es wirklich nicht! In dem Moment, wo Sie so etwas zu genau analysieren, zerstören Sie den Gegenstand Ihrer Analyse. Seit ich 28 bin, beschäftige ich mich mit dem, was mir im Leben am meisten Befriedigung verschafft. Ich habe bisher nie einen vernünftigen Grund gesehen, an dieser Situation etwas zu ändern. Geben Sie mir ein Mikrofon, zwei Plattenspieler, ein rudimentäres Mischpult wie das in meinem Büro hier im Haus und etwas Sendezeit, und ich bin glücklich! Ich werde das durchziehen, bis ich tot umfalle.
In der Tat produzieren Sie seit längerem eine Ihrer drei wöchentlichen „John Peel“-Shows direkt von zu Hause aus. Stimmt es, dass zunehmend auch einige der Live-Sessions hier entstehen?
Aber ja! PJ Harvey, Blur, Loudon Wainwright, die Super Furry Animals – die alle haben sich schon da hinten reingezwängt und für mich gespielt. Die White Stripes hatte ich neulich bereits zum zweiten Mal hier, Nina Nastasia noch öfter. Es mag nicht aussehen wie ein echtes Tonstudio, aber es funktioniert. Manchmal müssen wir Möbel verrücken oder einen Verstärker in unser Badezimmer stellen, na und? Besser, als nach London reinfahren zu müssen.
Jetzt bin ich doch überrascht. Es heißt immer, Sie seien ein absoluter Technik-Muffel und in diesem Punkt geradezu störrisch konservativ.
Habe ich das Gegenteil behauptet? Sagen wir es mal so: Ich kann moderne Geräte bedienen, wenn sie für mich von Nutzen sind. Mehr nicht. Wenn mir einer das Zeug erklären will, winke ich ab. Meine Kinder ärgern sich oft, weil sie mir heute noch regelmäßig zeigen müssen, wie man mit einem verdammten DVD-Player umgeht.
Neben Ihrer Musiksendung sind sie mit einem weiteren BBC-Format aktiv: „Home Truths“. Darin behandeln Sie skurrile bis schockierende menschliche Schicksale und Erlebnisse. Was fasziniert Sie daran?
Ich fand so etwas schon immer spannend – Geschichten, die nur das Leben schreibt. Kennen Sie diesen Roman in zehn Bänden von Anthony Poe namens „Dance To The Music Of Time“? Darin wird minutiös ein komplettes Dasein seziert. Ich liebe seinen Grundgedanken, dass die auf den ersten Blick monumentalsten Ereignisse oft nur wenig Spuren hinterlassen, während das Kleine, Abseitige nicht selten erst 20 Jahre später einen enormen Nachhall erzeugt. Vor einer Woche etwa hatte ich eine Frau in der Sendung, deren 19-jähriger Sohn auf einem Parkplatz von irgendeinem Schwachkopf zu Tode getreten wurde, weil er „zu groß“ war. Doch nicht alles, was wir behandeln, ist derart ernst. Es kann genauso gut um einen Typen gehen, der seinem Auto einen Mädchennamen verpasst…
…oder um einen fanatischen Fan des FC Liverpool, der seinem Nachwuchs diese Liebe in Form von Namen aufdrängt. Zwei ihrer Kinder heißen mit zweitem Namen Anfield, nach dem Heimatstadion Ihres Vereins, ein Sohn trägt sogar den Nachnamen des Managers Bill Shankly.
(lacht) Ursprünglich sollten alle vier Anfield heißen, aber meine Frau konnte das zum Glück verhindern. Seien Sie froh, dass ich nicht Fan von Borussia Mönchengladbach bin. Dann hieße meine jüngste Tochter womöglich Alexandra Bökelberg Ravenscroft. Welchen Verein unterstützen Sie?
Keinen. Ich mache mir persönlich nicht allzu viel aus Fußball.
Okay, das sei Ihnen verziehen. Besser so, als wenn Sie Arsenal- oder Manchester-United-Fan wären. So einer kommt mir nämlich nicht ins Haus. Ich meine das bitterernst.

„Eine Platte zu kaufen, macht mich definitiv glücklicher als eine umsonst zu bekommen.“
Zurück zur Musik: Gefällt Ihnen der Gedanke, dass Ihre Sendung von sämtlichen Programmen der BBC den größten Anteil an Hörern unter 16 hat? Im Grunde verhöhnen Sie damit das pseudo-pubertäre Gehabe jedes MTV-Moderators.
Das ist merkwürdig, nicht wahr? Ich denke, meine Hörer schätzen an mir, dass ich erst gar nicht versuche, sie zu verarschen. Sie honorieren, dass wir sie nicht einlullen und uns an sie ranschmeißen, um ihnen Sachen zu verkaufen. Für mich ist Radio eben gerade kein Marketing-Tool, verstehen Sie? Leute diesen Alters befinden sich mitten in der Pubertät – das allerletzte, was die gebrauchen können ist ein alter Sack, der ihnen erzählt, was sie tun, lassen und hören sollen. Die wollen sich ihre eigene Meinung bilden. Und dabei helfe ich ihnen.
Das ist der Punkt, der Sie aus dem Gros Ihrer Kollegen heraushebt: Ihr Jahrzehnte währender Kampf für neue, interessante Töne – von Punk über HipHop bis hin zu Drum’n’Bass oder Electronica. Der Versuch, Ihr Publikum stets mit Dingen zu konfrontieren, die es noch nie gehört hat. Im Grunde sind Sie mit Ihren fast 65 Jahren die lebende Antithese zu, sagen wir, Mick Jagger.
(lacht) Ja, das bin ich wohl. Manchmal war es allerdings ein ganz schöner Kampf, die Leute danach wieder auf andere Gedanken zu bringen. Besonders schlimm war das während der Punk-Ära: Entweder du spieltest Punk oder Reggae, das war auch noch akzeptiert. Aber wehe, ich schummelte mal einen alten Can-Track oder Ähnliches unter, dann war die Hölle los. Ich mag nicht, wenn mir jemand vorschreiben will, was ich zu senden habe.
Hatten Sie denn als Angestellter eines staatlichen Konzerns tatsächlich grenzenlose Freiheit, was die Gestaltung Ihrer Sendung betrifft, oder war das manchmal problematisch?
Es mag seltsam klingen, aber im Grunde… nein. Natürlich gab und gibt es generelle Meinungsverschiedenheiten, doch ich kann mich an keinen einzigen Fall in den vergangenen 35 Jahren erinnern, in dem die BBC mir gegen meinen Willen einen musikalischen Kompromiss aufgenötigt hätte. Selbst als ich während der Punk-Ära „God Save The Queen“ spielte, hielt mich niemand davon ab. Ich habe mich über die Jahre für den Sender unverzichtbar gemacht.
Und im Ausland? Immerhin arbeiteten Sie lange Zeit auch für BFBS, den damaligen Alliierten-Sender der Briten in Deutschland und produzierten bis vor kurzem auch ein regelmäßiges Programm für den Berliner Kanal Radio Eins.
Auch bei BFBS gab es höchstens gewisse Restriktionen und Regeln, was das bürokratische Prozedere oder die Form betraf, nicht jedoch bezüglich des Inhalts. Man durfte zum Beispiel keine deutschen Zivilisten direkt ansprechen oder namentlich nennen – aus urheberrechtlichen Gründen musste man so tun, als würden lediglich Armeeangehörige vor den Geräten sitzen. Da wurde dann halt aus Heinrich Schneider Richard Snyder, und der arme Wolfgang aus Bottrop fand zwar seine Wünsche berücksichtigt, aber nie öffentlich Erwähnung.
Warum haben Sie eigentlich damit aufgehört?
Aus Zeitgründen, ganz banal. (flüstert) Ich schreibe gerade an einer Autobiografie. Die haben mir 1,5 Millionen Pfund Vorschuss angeboten; ich wäre also bekloppt gewesen, das nicht anzunehmen. Aber danach würde ich schon gerne wieder. (überlegt) Wissen Sie, das Seltsame ist, dass ich während die Show lief, so gut wie keine Rückmeldungen von deutschen Hörern bekam – ganz im Gegensatz zu damals, als ich über BFBS zu empfangen war. Ich hatte den Eindruck, da hinten von meinem Büro aus in ein Vakuum hinein zu arbeiten.
Kommen wir noch einmal auf Ihre Faszination zu sprechen, was Tonträger anbelangt. Nicht nur Ihr Haus ist voll davon – im Garten befinden sich drei Hütten, die keinen anderen Zweck haben, als Ihrer Sammelwut Herr zu werden. Haben Sie ein bestimmtes System, nach dem Sie die Sachen ordnen?
Nicht wirklich. Gut, ich habe ein paar Listen angelegt, und zumindest meine CDs sind grob alphabetisch sortiert. Aber das meiste ist einfach… irgendwo. Ich bin eher ein Verfechter des Instinktes: Meine Plattensammlung ist eben keine Kirche, bei der die Methode, das System ja heute wichtiger ist als die eigentliche Aussage. Auf diese Art mag einem Großartiges entgehen, doch im Gegenzug fällt einem auch Ungeahntes in die Hände.
Gut vorstellbar, dass Ihre Frau nicht immer begeistert ist von Ihrer Sammelwut. Wie geht sie damit um?
Tja, da habe ich wirklich Dusel. Sheila schüttelt hauptsächlich gutmütig den Kopf und versucht, damit zu leben. Sie nimmt es mit Humor. Außerdem ist meine Frau so etwas wie mein lebender Terminkalender; ich wüsste nicht, wie ich meinen Alltag ohne sie meistern sollte.
Der erste Ort, den Sie und Ihre Frau auf der Hochzeitsreise nach Ägypten besuchten, soll ein Plattenladen gewesen sein.
Das könnte zumindest der Realität entsprechen. (kichert) Wo immer wir ankommen, schaue ich mich nach welchen um. Wir reisen jedes Jahr zu einem Festival namens ‚Noorderslag‘ nach Groningen – und ich gehe dort nicht eher weg, bis ich einige Stunden im ‚Plattenwurm‘ verbracht und den Laden leer gekauft habe. Ein echter Geheimtipp. Abgesehen von einer obskuren russischen Elvis-Pressung fiel mir dort seinerzeit meine erste White-Stripes-Single in die Hände.
Dabei denkt man, Sie bekämen alles, was derzeit auf dem Markt verfügbar ist, zugeschickt.
Wo denken Sie hin! Da draußen harren komplette Universen ihrer Entdeckung! Erst kürzlich bin ich in einem winzigen Shop über ein mir bis dato völlig unbekanntes Genre gestolpert: Underground Garage. Ausschließlich White-Label-Pressungen rätselhafter Urheber. Beim Verlassen des im Keller befindlichen Ladens ramponierte ich mir dann den Schädel. Aber was, bitte, ist eine kleine Kriegsverletzung gegen diesen sensationellen Fund? Eine Platte zu kaufen, macht mich definitiv glücklicher, als eine umsonst zu bekommen.
Würden Sie zustimmen, dass Ihr Musikgeschmack – im Gegensatz zu anderen Menschen – mit zunehmendem Alter sogar extremer wird?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest bin ich nie indifferent. Ich habe eine starke eigene Meinung, und die möchte ich auch vermitteln.
Für Ihre Kinder muss es in der Pubertät schwer gewesen sein mit einem Vater, der extremere Musik hört als sie selbst.
(lacht) Da mögen Sie allerdings Recht haben. Wenn einem die eigenen Kids mit bekümmerter Miene nahe legen, das „scheußliche Gewummer“ leiser zu drehen, damit sie fernsehen können, fühlt sich das in der Tat ein wenig seltsam an.
Sie sollen sogar Death Metal mögen.
Allerdings. Death Metal ist wie Blues: eine extrem restriktive Musikform, die dem Musiker dennoch fast unbegrenzte Variationsmöglichkeiten bietet. Manches davon ist auf geradezu groteske Art geschmacklos.
Mochten Sie demnach auch in den Achtzigern Heavy Metal? Der war ja mindestens ebenso geschmacklos.
In diesem Punkt muss ich Sie enttäuschen. Ich respektiere Led Zeppelin oder Deep Purple, die Achtziger habe ich anderweitig verbracht. Black Sabbath waren ebenfalls großartig ganz zu Beginn ihrer Karriere. Ich hätte sie sogar um ein Haar für mein katastrophal unerfolgreiches Plattenlabel ‚Dandy Line Records‘ unter Vertrag genommen, als ich sie vor dreißig Jahren in Wolverhampton spielen sah. Aber Sie wollten leider nicht. (lacht)
Sie haben alle Phasen der Rockgeschichte persönlich begleitet. Wie steht’s mit einer Lieblings-Periode?
Ich bin mir dessen bewusst, dass die Leute dies von einem Mann meines Alters erwarten. Aber – nein. The Byrds hatten, obwohl sie sich persönlich als arrogante Bastarde und wahre Landplage heraus stellten, ebenso ihre Zeit wie die Stones, Roxy Music oder The Cure. Ich schätze mich glücklich, nicht von der Vergangenheit zehren zu müssen. Es ist im Grunde wie mit Tageszeitungen: Da will man ja auch eher die aktuelle Ausgabe lesen und nicht eine von vorgestern.
Zur Person

John Peel
Eine kurze Biografie
John Peel wurde am 30.08.1939 als John Robert Parker Ravenscroft in Heswall bei Chester geboren. Nach dem Wehrdienst verschlug es ihn Anfang der Sechziger nach Dallas, wo er eher zufällig mit dem Medium Radio in Berührung kam. Es folgten Anstellungen in Oklahoma City und Los Angeles. Zurück in der Heimat, moderierte Peel zunächst für den Piratensender Radio London die Nachtsendung „The Perfumed Garden“, bevor er 1967 zur BBC-Neugründung Radio 1 wechselte. Sein Hunger nach unverbrauchten, oft auch extremen Tönen war legendär und nicht unerheblich am Durchbruch von Genres wie Punk, HipHop, Drum’n’Bass und Electroclash beteiligt. Ab 1998 war der Vater von vier Kindern neben der eigenen Show mit dem Format „Home Truths“ bei der BBC zu hören. Seine zweite Frau Sheila, mit der er nördlich von London in einem abgeschiedenen Landhaus lebte, nannte John Peel liebevoll Pig, „weil sie beim Lachen immer so grunzt“. Am 25.10.2004 erlag John Peel während eines Urlaubs in Peru einem Herzinfarkt. Seinem Wunsch gemäß steht auf seinem Grabstein eine Songzeile der Undertones: „Teenage Dreams, so hard to beat.“